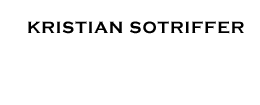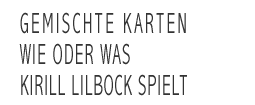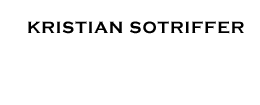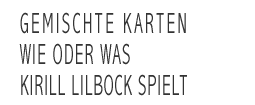|
Das Spiel, wie es Kirill Lilbock auf seine Art betreibt, hat einen
Namen, und der
lautet “Transformation”. In sie mischt der Künstler
Ironie und Doppelbödigkeit ein.
“Ich glaube”, schreibt der als Museumsmann praktizierende
Theoretiker Jean Chri
stophe Ammann (“Kunst unter Tränen - Warum die Malerei wieder
wichtig werden
wird” - In : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16. 6. 2001 )
- “ich glaube, daß
dem Schaffen des Künstlers prinzipiell Ironie zugrunde liegt
- allein deshalb, weil
er, was ihn bewegt, einem transformatorischen Prozeß unterwirft.
Ironie schafft
jene Distanz, die das Werk befähigt, dem Zeitgeist zu entfliehen”.
Es gehe schließlich nicht darum,, dem Opportunismus zu frönen,
sondern “die Grat-
wanderung zwischen externen und internen Einflüssen produktiv
umzusetzen”. Das
liest sich wie auf Kirill Lilbock gemünzt, wobei auf dessen kulturelle
Identität ange
spielt zu werden scheint, die ihm ja - seit über zwanzig Jahren
an der Bruchstelle
zwischen Ost und West, in Wien also lebend - zum Teil abhanden gekommen
ist.
Ammann denkt nämlich auch an jene Künstler, “die in
der westlichen Zivilisation
leben, arbeiten ..., deren kollektives Gedächtnis jedoch mit
einem anderen kultu
rellen Erbe, mit anderen Familientraditionen, anderen gesellschaftlichen
Struktu
ren und religiösen Vorgaben konnotiert ist”.
Trifft alles auf Kirill Lilbock und seinen künstlerischen Behauptungswillen
zwischen
den Welten, alten und neuen, zu. Also zwischen der russischen Ikone
und ihrem
je nach hervorgehobener oder vernachlässigter Bedeutung Vermischten
von klein
en und großen Figuren, Figurenteilen, Objekten, Phänomenen.
Sie verhelfen ihm
zu jenem “inneren Rahmen”, innerhalb dessen Verstreutes
zusammenfinden und
eine Art Einheit unter Einschluß absurd anmutender Zutaten bilden
kann. Etwa
durch das Einführen jenes Zeichens, das sich als “kleine
Seele” in ein Bildge
schehen eingemischt zeigt. Dazu kommen: Verschattete, zugleich aufgelichtete
Zonen, irisierendes Farbenspiel, Fluktuation, etwas Flackerndes,
Züngelndes in
vermischten, oft verklausulierten Zusammenkünften von mitunter
wie Feuerwerks
körper verzischenden Versatzstücken, deren Sichausbreiten
momentaufnahmen
artig zum Bild wird.
Eine gewisse Heiterkeit und helle Leichtigkeit scheint die kleinen
Kosmen zu be
stimmen, die sich oft auch blütenartig auffächern als “Spielende
Zeichen” (1995).
Genaueres Hinsehen aber vermittelt einen Eindruck von den Anstrengungen,
denen sich der - eher langsam, behutsam vorgehende - Künstler
unterwirft,
wenn er seine eigene Bilddialektik aus Naturbezügen, Konstruktionen,
Kombina
tionen herstellt.
Das spielerische Element, aus dem heraus er in wechselnden Entscheidungen
und aus einem gewissen Fundus schöpft, entpuppt sich dann als
mit viel beweg
licher Nachdenklichkeit verbunden.
Lilbock schöpft seine das Flüchtige, Ephemere, Losgelassene
in gewisse Systeme,
Koordinaten einbindende, kategorisierende, festigende Ordnungen als
Situativem
aus zahlreichen Zuflüssen. Damit parallel verläuft seine
das mitunter Flatternde
der Bildbewegungen bindende Vorgangsweise. Dem Informellen, Lyrischen
oder
Expressiven in seinen kleinen Galaxien legt er Bahnen. Auf diese Weise
gelingt
ihm eine Art Szenenaufbau, das Entwickeln von Prospekten aus zahlreichen
Ele-
menten und den in sie eingestreuten Störfaktoren.
Ein meist zartes Geäder bestimmt seine im Aus- und Einholen zusammengeführ
ten Partikel in ihren einerseits chiffrierten, andererseits dechiffrierten
Erschei
nungsformen. Zu ihnen zählt der Regenbogen, der Fisch, die Frucht,
der
Schmetterling - und schließlich die Ameise als Symbol für
die vorbeieilende Zeit,
innerhalb derer sich das Leben entwickelt und auflöst Für
dieses Leben schafft
Lilbock Gehäuse, in die sich einbetten läßt, was er
der Fülle von Erscheinungen,
Erfahrungen, Erinnerungen abriebartig abgewinnt und was er zueinander
in Be
ziehung setzt. Mit ein We-sensmerkmal seiner oft Stufen legenden,
gestückelten,
ein Bild-im-Bild-System ausarbeitenden, häufig gelängten
Tafeln bildet ihr pyra
mi-denartiger Aufbau. In ihn mischt sich etwas ein wie ein Tanz, ein
Wirbel, der
den Künstler aus sich selbst herausschleudert, zur Entäußerung
oder einem Außer
sichsein gelangen läßt. Dann schiebt er einen Vorhang zur
Seite und macht den
Blick frei in eine Art Traumland; öffnet das eine oder andere
Fenster als Einstiegs
möglichkeit ins Eleusische. Die Gleichzeitigkeit eines Geschehens
unterstreicht
Lilbock zudem durch das Mitein-ander des Fluiden mit dem gefestigt
Strengen,
den geometrischen Einsprengseln beispielsweise. Je nach Vorgangsweise
verschieben sich die Bedeutungsfelder, innerhalb derer operiert
wird - assoziativ
und dem unmittelbar auftretenden Impuls gegenüber offen. Auch
bei gleichblei
benden oder verwandten Metaphern mischt sich stets ein neuer Klang
ein, so wie
dem Blau oder Grün der Natur der harte Kontrast des fremden Zeichens
- des
Anderen - entgegengehalten wird. Sinnlos wäre es, bei einem Künstler,
der sich
im Internet bewegt und sich der dort vorrätigen Einblicke in
die Geschichte der
Malerei bedient, nach bestimmten Einflüssen oder Parallelen zu
forschen. Es gibt
sie und es gibt sie auch wieder nicht, weil Lilbock ja alles, was
er findet, auf seine
Art bündelt und bindet, wobei er sich erlaubt, die Zügel
relativ locker zu halten.
Aber er hält sie, und Bedachtsamkeit ist auch dann mit im Spiel,
wenn etwas wie
eine Seifenblase und die Spiegelungen auf ihr erscheint.
Lilbock nimmt sein Spiel also ernst. Er grübelt. Forscht. Sucht
Distanz und aus ihr
heraus Nähe. Das Destillat seines Empfindens aber läßt
er dann mehr oder we
niger spontan aus sich herausfahren, löst es ab von der Schwere
des Denkens und
läßt es in dem von ihm geschaffenen Bildraum umherziehen,
woraus jedes ein
zelne Stück seine Autonomie gewinnt. Seine die großmächtige
Geste und alles bril
lante Getue vermeidende Art zu malen erscheint völlig identisch
mit seiner gespal
ten-geschlossenen Persönlichkeit und infolgedessen volkommen
authentisch. Er
ist der Kokon, das Verpuppte, aus dem heraus sich seine schmetterlingsartigen
feinen ( Pinsel-) Schläge entfalten.
|
 |
Kristian
Sotriffer |
|